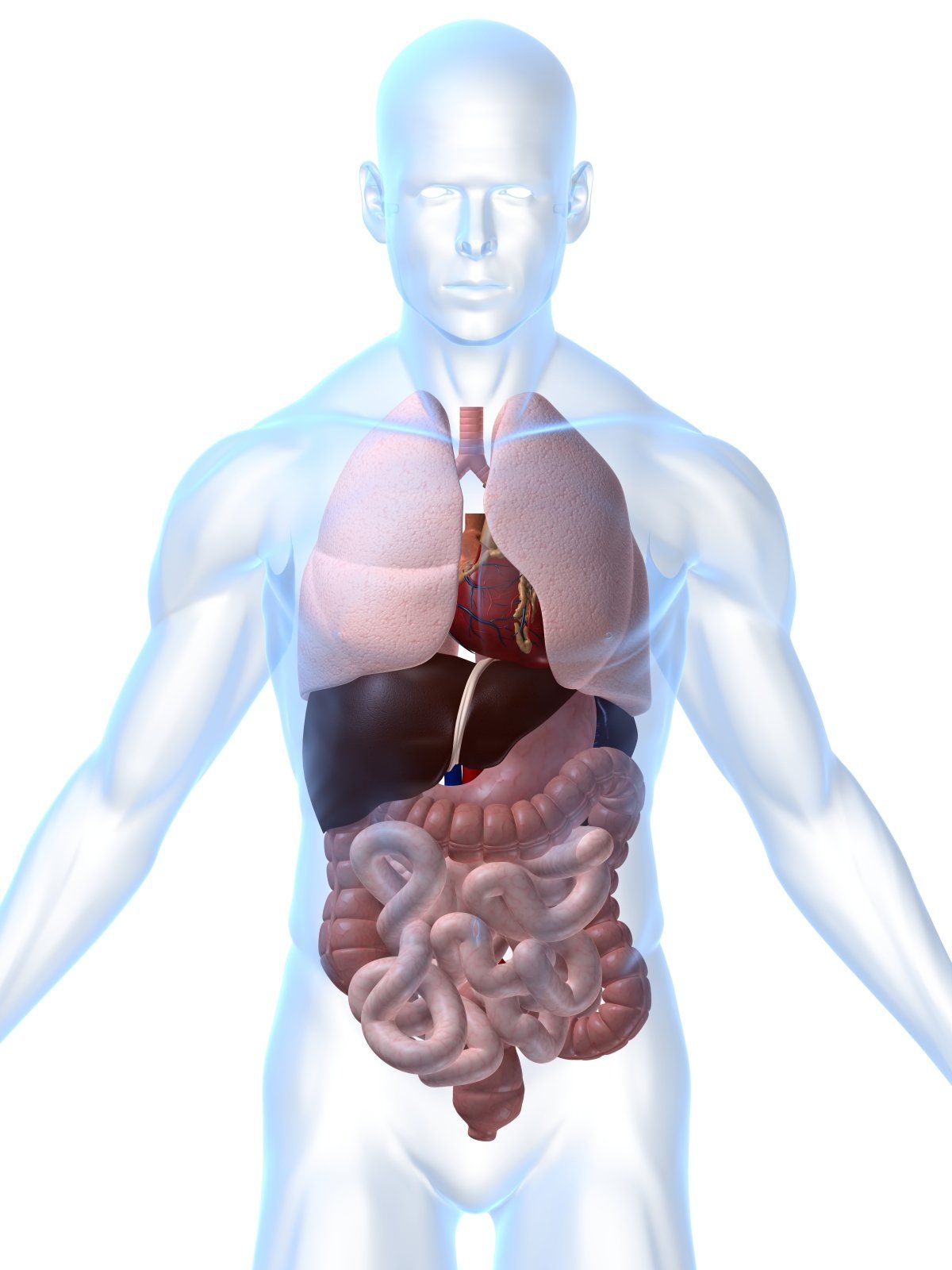Der weiblich Zyklus und die Jahreszeiten
18. Februar 2020
Wusstest du das man den weiblichen Zyklus mit den Jahreszeiten vergleichen kann?
Der Mensch und die Natur sind zyklische Wesen. So verläuft jeder Tag im Morgen-, Mittag-, Abend- und Nachtzyklus. Jede Mondphase mit zunehmenden Mond, Vollmond, abnehmenden Mond und Neumond. Jedes Jahr mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌷Die erste Zyklushälfte bezeichnen wir als Frühling. Hier ist es oft so, dass wir neue Projekte beginnen wollen, voller Motivation sind und gern neue Kontakte knüpfen. Der erhöhte Östrogen Spiegel bewirkt den Aufbau unserer Gebärmutterschleimhaut und auch psychisch befinden wir uns in einer Wachstumsphase. ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
☀️Während der fruchtbaren Zeit, also um den Eisprung rum, ist der Sommer. Oft fühlen wir uns dann besonders wohl in unserem Korper, flirten gerne und haben vermehrt Lust auf Sex.
Spaß und Sport stehen jetzt ganz hoch im Kurs.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🍁Die zweite Zyklushälfte vergleichen wir mit dem Herbst. Wir fahren runter, schlafen mehr, mögen es kuschelig, sind kreativer und besonders emphatisch. ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
❄️Die Zeit der Menstruation ist der Winter. Hier möchten sich die meisten Frauen zurück ziehen. Wie regenerieren und reinigen uns. Hier sollten wir auf unsere Intuition hören und auch Mal zulassen, dass uns gerade nicht nach vielen Kontakten oder Partys ist.
____________________________________
🌱Findest du dich darin wieder?

1# bisher mehr als 200 verschiedene Inhaltsstoffe nachgewiesen 2# besteht zu 99% aus Wasser 3# soll antientzündlich, antibakteriell, antiviral, feuchtigkeitsspendend und wundheilend wirken 4# die wildlebende Pflanze kann monatelang ohne Regen auskommen 5# das Gel kann äußerlich und innerlich eingesetzt werden, als Tinktur, Salbe, Tee (innerliche Anwendung bitte nur in medizinischer Begleitung) Du kannst die Aloe Vera Pflanze ganz einfach zuhause im Topf züchten. Bei Bedarf schneidest du einen Teil (am besten ein ganzes Blatt) der Pflanze ab und nutzt das Gel im Inneren des Blattes. Tipp: den Rest des Blattes kannst du ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahren. Schon mal ausprobiert? :)

Ernährung, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Elternsein... in vielen Dingen streben wir nach dem „Perfekten“. Die Ernährung sollte biologisch, saisonal, regional, Fairtrade, vegetarisch/vegan, gesund, vollwertig, gluten- & laktosefrei und nicht in Plastik verpackt sein. Ja, ein erstrebenswertes Ziel, aber umsetzbar? Es gibt sicherlich einige Menschen die es schaffen diese Sachen umzusetzen, aber das erfordert Zeit, Energie, Motivation und Disziplin. Meiner Meinung nach führen auch kleine Schritte zum Erfolg und damit sollte man beginnen. Nicht von heute auf morgen alles versuchen umzustellen, um dann doch zu scheitern, sondern nach und nach schauen was jetzt gerade möglich ist! Wie oft habe ich schon Sätze gehört wie: „Naja Person X lebt zwar vegetarisch aber fliegt ständig mit dem Flugzeug in den Urlaub“ oder „Person Y nimmt ja das E-Bike zur Arbeit, der Nachhaltigkeit wegen, benutzt aber Kaffeekapseln“. Ja, „perfekt“ ist das nicht, aber ich finde jeden einzelnen Schritt toll, den jemand macht- für seine Gesundheit, für die Umwelt, für den Tierschutz oder sonstigen Zielen dieser Art. Muss man sich als Eltern schlecht fühlen wenn man Wegwerfwindeln statt Stoffwindeln benutzt? Wenn man Gläschen gibt anstatt jeden Tag selber zu kochen? Ist es verwerflich Bio-Tomaten in Plastik verpackt zu kaufen? Den perfekten Menschen gibt es nicht. Wir sollten uns gegenseitig unterstützen und inspirieren anstatt radikal zu denken. Fühlt euch gut für das was ihr schafft und nicht schuldig für Dinge die ihr noch nicht erreicht habt. Mein Tipp: Denkt jeden Sonntag Abend drüber nach was ihr in dieser Woche ändern könnt. Das kann eine Kleinigkeit sein, wie z.B. eine Holzzahnbürste zu kaufen, Jutebeutel mit zum einkaufen zu nehmen oder im Bio- / Unverpacktladen einzukaufen. Am nächsten Sonntag reflektiert ihr wie umsetzbar das war und ob ihr das so weiter machen wollt / könnt. Und formuliert ein nächstes Ziel. Manchmal stehen aber auch andere Sachen im Leben an und es passt gerade nicht, dann ist das auch ok.

-Südafrika 2012- Endlich angekommen. Ob ich überhaupt fliegen kann, stand bis kurz vor Abreise nicht fest, hatte ich mir nämlich kurz zuvor einen fiesen Infekt im asiatischen Ausland geholt und durfte ein paar Tage in Quarantäne verbringen. Glücklicherweise doch kein Malaria, Hepatitis oder ähnliches. Aufregend und nervenaufreibend. Am Flughafen werde ich von einem Mitarbeiter der Universität, an der ich Supervision bekommen werde und in dessen Studentenwohnheim ich wohnen werde, abgeholt. Die Uni ist eine Partnerstätte meiner holländischen Uni. Da ich einige Zeit später anreise als alle anderen wurden die Arbeitsplätze bereits vergeben und ich hatte keine Entscheidungsfreiheit mehr. Ich hatte aber Glück, denn ich wurde genau da eingeteilt wo ich hin wollte. Halbtags in eine der größten Psychiatrien Südafrikas und zudem in einer Kindertagesstätte im Township. Vor allem die Psychiatrie interessiert mich brennend, denn dies war auch im Studium immer mein Schwerpunkt. Zwei weitere Studenten arbeiteten in den gleichen Einrichtungen wie ich. In der Psychiatrie durften wir uns aussuchen welche Stationen uns besonders interessierten und wo wir gern eingeteilt werden würden. Schnell wurde deutlich das wir eher als „fertige“ Kunsttherapeuten gesehen wurden und wir sehr selbstständig arbeiten würden. In einer deutschen Psychiatrie nicht denkbar, dass Studenten im dritten (vorletzten) Studienjahr einfach „auf die Patienten losgelassen werden.“ Auf der einen Seite fand ich das schade, hätte ich mir doch gerne Methoden von erfahrenen Therapeuten abgeschaut, auf der anderen Seite eine tolle Herausforderung von der ich sicher viel lernen konnte. Die Abteilungen, in denen wir arbeiten würden, waren: Allgemeine Psychiatrie Forensik Drogenentzugsprogramm In der Abteilung „Allgemeine Psychiatrie“ waren Patienten mit Erkrankungen mit psychiatrischen Diagnosen wie z.B. Borderline, Schizophrenie, Psychose, Depression, Essstörungen... In der Abteilung „Forensik“ waren Patienten, die eine Straftat begangen haben und auch eine psychiatrische Diagnose haben. Statt Gefängnis also Psychiatrie. Die Straftaten waren in den allermeisten Fällen Mord und Vergewaltigung, manchmal auch Mehrfachmord. Selten ging es um illegale Geldgeschäfte o.ä. Die „SATU“- Substance Abuse Treatment Unit- war ein vierwöchiges Drogenentzugs-Programm. Viele Menschen die alles in Ihrem Leben aufgrund von Drogenmissbrauch verloren hatten – oder auch nie etwas hatten. Der lange Drogenkonsum stand den meisten ins Gesicht geschrieben, eingefallene Gesichter, zernarbte Körper, junge Menschen sehen aus wie mind. 30 Jahre älter. Viele litten unter Vergewaltigungen in der Vergangenheit oder dem Verlust eines Familienmitglieds durch Mord. So hatte ich das Gefühl, auf der einen Seite mit den Tätern und auf der anderen Seite mit den Opfern zu arbeiten. Aber so einfach zu unterteilen ist das natürlich nicht. Die erste Therapiestunde in der Forensik steht an. Ich frage mich wie ich mich dabei wohl fühlen würde, war ich ja zuvor noch nie (zumindest bewusst) einem Mörder oder Vergewaltiger begegnet. Es war eine Gruppentherapie mit, ich glaube, vier Patienten. Zunächst alle recht zurückhaltend. Sie sprachen gebrochenes Englisch, ich war aber überrascht wie gut. So saß ich dann also vor einer Gruppe Schwerstkrimineller. Es fühlte sich aber nicht so an. Ich sah wie immer den Patienten, den Menschen hinter der Erkrankung, hinter der „Tat“. Und die Arbeit machte Spaß. Ich habe schnell bemerkt, dass viele Methoden die wir in Holland / Deutschland anwendeten hier nicht zu gebrauchen waren. Abstraktes Denken und die kognitive Fähigkeit eine Aufgabe zu verstehen und dann umzusetzen war bei einigen extrem eingeschränkt. Es lag nicht an der Sprache, sondern wahrscheinlich an mangelnder Bildung aber auch viel an der Krankheit, lebten einige Patienten in ihrer ganz eigenen Welt. Zu dem kam oft, dass die Patienten in der Forensik und Allgemeinen Psychiatrie einen Haufen Medikamente bekamen, so dass sie oft wie betäubt waren, manchmal nicht auf Fragen antworten konnten und leer in den Raum starrten. Trotzdem fanden die Patienten in der Kunst ein Mittel zum Ausdruck. Die Fortschritte waren klein, aber vorhanden. Ich freute mich auf die Therapiestunden, es wurde gelacht, getanzt, gegrübelt und geweint. Es kamen immer wieder neue Patienten dazu, andere mussten die Therapie aus irgendwelchen Gründen abbrechen. Nach einigen Wochen, nachdem bekannt wurde, dass eine Ergotherapeutin beinahe von einem Patienten vergewaltigt wurde, kam bei uns die Erkenntnis auf, dass wir vielleicht einen Security während der Therapie im Raum haben sollten. Als wir danach fragten wurden wir verwundert angeschaut: „Wie? Ihr seid ohne Security während der Therapiestunden?“ In Deutschland undenkbar, dass so eine Sicherheitslücke passiert, schätze ich. Ab da war also immer jemand mit im Raum. Angst etwas könnte passieren hatte ich aber, meine ich zumindest rückblickend, nie. Auch wenn durchaus mal Patienten halluzinierten, sich stritten, oder mit stolz verkündeten ihre Mutter getötet zu haben. Trotzdem waren die Patienten irgendwo und auf irgendeine Weise liebenswert. Als ich mich nach einem knappen Jahr Arbeit von Ihnen verabschiedete musste ich weinen. In der SATU hatten wir nur vier Wochen Zeit um den Patienten wieder auf die Beine zu helfen. Eine sehr kurze Zeit und die Therapiestunden waren dementsprechend auch strukturierter als in der Forensik. Themen waren Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft, Selbstwertgefühl, der Umgang mit Emotionen und Abschied nehmen. „Was möchte ich ändern und warum? Wie vermeide ich Trigger? Was tut mir gut und was nicht?“. Ziele wurden ausgearbeitet und formuliert. Die Kunsttherapie integrierte sich recht schnell als neuer, erfolgreicher Teil des Programms. Die Psychiatrische Anstalt war generell ziemlich anders, als ich es aus Deutschland kannte. Während ich in meinem Studium lernte, dass die Würde des Patienten oberste Priorität hat, er sich als Mensch wahrgenommen fühlen muss und man ihm mit Empathie gegenübertreten soll, stand der Stempel „Patient“ den Patienten in der südafrikanischen Psychiatrie fett auf die Stirn geschrieben. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn jeder Patient bekam Patientenkleidung (im Prinzip ein Schlafanzug, den sie den ganzen Tag anhatten) bei dem auf jedem Kleidungsstück „Patient of …...psychiatric hospital“ stand. Auch eine Mütze, mit Aufdruck direkt über der Stirn. Die forensischen Abteilungen der Klinik erinnerten mich (tut mir Leid für den Ausdruck) an einen Zoo. Das erste was man sah, war eine riesige Glaswand, hinter der ein grauer Innenhof war. Kaum grün, keine Stühle, Bänke, Tische..., keine Beschäftigungsmöglichkeiten. Dies war der Hauptaufenthaltsort der Patienten. Therapiestunden gab es wenig und so war es tatsächlich so, dass die meisten Patienten einfach den gesamten Tag auf diesem Hof verbrachten. Würdevoll war das irgendwie nicht. Die „Zimmer“ glichen eher Gefängniszellen aus alten Filmen. Ja, ich weiß, die Patienten waren ja auch kriminell, aber es unterschied sich einfach so viel von dem was ich gelernt habe. Die Reflexionsrunden mit den Patienten liefen auch ganz anders ab. So saßen fast alle Krankenschwestern, Ärzte und Therapeuten in einem großen Halbkreis im Raum. Davor stand ein leerer Stuhl auf den sich dann ein Patient setzte, wie auf dem Präsentierteller und dann wurde über Krankenakte, Entwicklungen, Fehltritte usw. diskutiert. Klar, die meisten Patienten waren sehr eingeschüchtert von der Situation. Alles in allem musste ich viele meiner ethischen Grundlagen ablegen und mich anpassen. In meinen Therapiestunden und im kleinen Rahmen versuchte ich natürlich weitgehend das umzusetzen was ich, zumindest in meinem Beruf als Therapeutin, für richtig halte: jeden Menschen mit Würde und Respekt zu begegnen und ihn als Mensch wahrzunehmen. Rückblickend war die Zeit dort unheimlich lehrreich. Ich habe einige, hier selbstverständliche, Dinge zu schätzen gelernt und fand meine Position zwischen Distanz und Empathie, scheinbaren Tätern und Opfern, geplanten und nicht-planbaren und irgendwie auch zwischen Europa und Südafrika.

Die „Goldene Milch“ ist ein Getränk mit ayurvedischen Wurzeln. Im Ayurveda schon lange Zeit bekannt und eingesetzt, zieht es bei uns, im Westen, gerade erst ein. Als „Superfood“ angepriesen, werden ihm viele positive Eigenschaften zugeschrieben. Ja, es ist ein Trend, aber an diesem Trend ist auch was dran. Ich möchte euch zeigen was an der Goldenen Milch so gesund ist, wann man sie einsetzen kann und wie einfach die Herstellung ist. Die Zutaten: - Wasser - Pflanzenmilch (Mandel-, Cashew-, Kokos-Reis oder Hafermilch; ohne Zusatzstoffe!) - kleines Stück frischen, geriebenen Ingwer - Kurkuma Pulver (aus dem Bioladen) - natives Kokosöl (dient der Bioverfügarkeit) - Pfeffer - optional / je nach Geschmack: Agavendicksaft, Ingwer, Zimt, Kardamom, Muskatnuss Was ist jetzt das Besondere an diesem Getränk? Es ist das Kurkuma, denn das darin enthaltene Curcumin soll eine entzündungshemmende, schmerzlindernde Wirkung haben. Es soll den Körper vor Infektionen schützen, bei Verdauungsbeschwerden und selbst bei Krebs und Alzheimer positive Einflüsse haben. Außerdem wird es zum Abnehmen und zum senken des Cholesterinspiegels empfohlen. Ein echter Allrounder. (Diese Erkenntnisse sind zum Teil nicht von der evidenzbasierten Medizin anerkannt und beruhen auf Beobachtungen in der Naturheilkunde) Auch Kokosöl, Ingwer und Zimt werden positive Faktoren für die Gesundheit zugeschrieben. Die Zusammenstellung in der Goldenen Milch ergibt ein total leckeres Getränk (zugegebenermaßen bei manchen zu Beginn gewöhnungsbedürftig), welches sogar unseren geliebten Morgenkaffee Konkurrenz macht. Ich bin generell kein Fan von „Hypes“, „Wundermitteln“ oder „Allheilmitteln“ und deswegen denke ich auch nicht, dass die Goldene Milch ein, über lange Zeit bestehendes, Problem einfach heilt. Meist sind chronische Krankheit multikausal (mehrere Ursachen) und da empfehle ich definitiv eine ganzheitliche Behandlung. Trotzdem ist die Goldene Milch etwas was man zuhause ganz einfach ausprobieren kann. Auch Gesunde, die sich einfach etwas Gutes tun wollen, sind mit dem Superdrink sicher gut beraten. Vor allem jetzt in der Erkältungssaison. Meine Empfehlung also: Probiert es aus! Vielleicht merkt ihr eine Linderung eurer Beschwerden, vielleicht schmeckt es euch auch einfach gut, vielleicht fühlt ihr euch stärker und weniger müde und eventuell verschwindet ein Infekt schneller. !Aufpassen müssen Menschen mit Gallensteinen, /Gallenwegsproblemen und (wie leider so oft), Schwangere! Die Herstellung Auf traditionellen Wege wird zunächst eine Kurkuma-Paste hergestellt die dann in die Milch eingerührt wird. Wer einen Thermomix zur Verfügung hat, hat es noch ein bisschen einfacher. Für eine Portion: 120ml Wasser 350 ml Pflanzenmilch (315g) (Mandel-, Cashew-, Kokos-Reis oder Hafermilch; ohne Zusatzstoffe!) 1 EL Kurkuma Pulver (aus dem Bioladen) 1 TL natives Kokosöl (dient der Bioverfügarkeit) 1 Prise Pfeffer - optional / je nach Geschmack: Agavendicksaft, Ingwer, Zimt, Kardamom, Muskatnuss, echte Vanille Die traditionelle Herstellung im Topf: 1. Das Kurkuma Pulver und das Wasser in einem Topf verrühren und erhitzen. 2. Den Ingwer reiben und langsam dazu geben und rühren Es entsteht eine Paste. Diese könnt ihr nun direkt verwenden. Mein Tipp: Ihr könnt auch eine größere Menge dieser Paste herstellen, denn sie hält sich im Kühlschrank ca. eine Woche. Dann braucht ihr nicht jeden Tag aufs neue die Paste herzustellen, sondern könnt sie gleich in die Milch einrühren. 3. Die Pflanzenmilch erhitzen (nach Geschmack kann man natürlich auch einen Teil aufschäumen und eine Art „Latte“ daraus machen). 4. 1 EL der Paste (evtl. erst weniger um sich an den Geschmack heranzutasten), das Kokosöl, evtl. einen Schuss Agavendicksaft (zum Süßen) und jeweils eine Prise der Gewürze (bis auf den Pfeffer) hineinrühren. 5. Ca. zwei Minuten köcheln lassen, Prise Pfeffer hinzugeben und genießen. Die Herstellung mit dem Thermomix: Optional: statt den Ingwer mit der Hand zu reiben, vorher im Thermomix zerkleinern. (Stufe 8) 1. Ingwer bei Stufe 8 zerkleinern / mit Spaten nach unten schieben 2. Wasser (100g) und Kurkuma hinzugeben / Stufe 4 / 5 Sekunden vermischen (Evtl. etwas weniger Kurkuma, um sich an den Geschmack heranzutasten) 3. 9 Minuten / 100 Grad / Stufe 2 4. Alle weiteren Zutaten (bis auf den Pfeffer) hinzugeben. 5. 2 Minuten / 90 Grad / Stufe 2 6. Pfeffer hinzugeben und genießen *Auch hier kann man optional geschäumte Milch, für eine Art „Latte“ hinzugeben.